Flirt
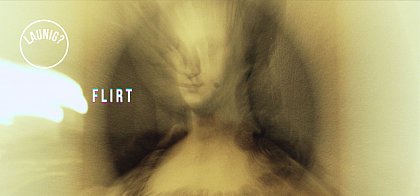
Friedrich Gottlieb Klopstock an Meta Moller (8. April 1751)
Liebe, kleine Mollerin,
Sehen Sie, weil Sie keinen größeren Beweis der Freundschaft als das Schreiben verlangten, so schreibe ich schon an Sie.
Kaum habe ich mich von dem Schrecken erholt, in das ich geriet, als ich Sie beim Abscheide krank sah. Werden Sie mir ja nicht wieder krank, meine kleine liebe Freundin. Und gehen Sie fein hübsch früh zu Bette. Ferner bessern Sie sich auch darin, dass Sie mich nicht mehr auf dem Fuß eines neuen Freundes ansehen. Das verlange ich durchaus von Ihnen.
Ich habe Sie recht sehr lieb. Sie können mir, dächte ich, nur auch immer ein bisschen gut sein. Das hat mich so schrecklich verdrossen, dass Sie‘s, in Betrachtung der neuen Robe[1] nicht gerade auf meinen Geschmack wollten ankommen lassen. Sehen Sie, was Sie für Unheil damit angerichtet haben. Nun weiß ich‘s nicht bestimmt, was für Blumen Sie künftigen Frühling auf die Alster begleiten werden. Und ich wollte doch gern eine völlig richtige Vorstellung von allen Kleinigkeiten, die Sie umgeben, haben, wenn ich Sie mir mit einigen, doch nicht allzu treuen Seufzern, auf der Alster oder Promenade[2] denken werde. Doch Mannspersonen, wie ich bin, dürfen dergleichen Freiheiten nicht verstattet werden.
Ich merke, dass ich anfange böse zu werden. Ich will nur schließen. Meine Hochachtung! Das versteht sich von selbst. Ich bin
Ihr ergebener Freund Klopstock.
Oh, lassen Sie mich einen Brief von Ihnen in Kopenhagen bei dem Buchhändler Mumma finden. Machen Sie mir doch die Freude.***
[1] Gemeint ist ein neues Kleidungsstück, vermutlich ein Kleid.
[2] Margareta Moller stammte aus Hamburg. Sie lebte bei der ersten Begegnung mit F.G. Klopstock im Haus ihrer ältesten Schwester.
Meta Moller an Friedrich Gottlieb Klopstock (13. April 1751)
Ihr Brief, den ich lange noch nicht erwarten konnte, hat meine Freundschaft zu Ihnen gewiss viele Jahre älter gemacht. Sie haben es wohl gemerkt, dass ich schon große Lust hatte, wie Sie noch in Hamburg waren, Sie nicht als einen neuen Freund anzusehen. Ich musste mir aber doch Gewalt antun, mich dieser Lust nicht sogleich zu überlassen, weil es doch möglich war, dass die guten Eigenschaften, die ich an Ihnen bemerkte, nur so schienen. Ist es recht wahr, dass sie mir gut sind? Ich glaube es beinahe. Sie sind so gut gewesen alle Zeit, die Ihnen nur möglich war, bei mir zuzubringen, und schreiben schon den Tag nach Ihrer Abreise an mich.
Ob ich Ihnen gut bin, das wissen Sie wohl, und ich sehe es nunmehr wohl ein, dass es nur aus einer kleinen Eitelkeit hergekommen, wenn Sie mich so oft danach gefragt. Machen Sie nur nicht, dass ich es einmal bereue, dass ich jetzt, zum ersten Mal in meinem Leben, jemand so geschwinde bin gut geworden. In der Entfernung, wie wir jetzt sind, können Sie das schon dadurch verhüten, dass Sie fleißig an mich schreiben Das ist wenigstens ein Zeichen, dass Sie mich nicht ganz vergessen.
Sie verweisen es mir mein lieber Klopstock, dass ich in Ansehung des Tafts[3], es nicht habe gänzlich auf Ihren Geschmack wollen ankommen lassen. Woher könnte ich aber wissen, dass Sie, als eine Mannsperson einen guten Geschmack darin hatten. Es folgt doch nicht, wenn man in einer Sache einen guten Geschmack hat, dass man es auch in einer andern hat. Es folgt doch gar nicht, dass ein großer Poet ein großer Kenner von Taftmuster sei. Wenn ich das nur einigermaßen hätte vermuten können, so würde ich gar keine Schwierigkeiten gemacht haben.
Auf dass Sie Sich es aber gänzlich vorstellen können, so will ich Ihnen wiederholen, was ich Hr. Rahn[4] gesagt habe; es kann ihm auch zu einer Erinnerung dienen, wenn er es etwa nicht recht mehr wüsste. Es soll ein sehr freies Muster sein, viele Stängel, wenig und kleine Blumen und Blätter. Ich sähe noch lieber, wenn es zusammenhängend wäre als in abgesonderten Sträußen. [...]
Sie schließen Ihren Brief recht nach Ihrem kleinen Kopfe. Sie merken, dass Sie böse werden? Und warum? Weil ich Sie eine Mannsperson genannt, und mich doch so gegen Sie aufgeführt habe, als wären Sie ein Frauenzimmer. Sie verdienen kaum hiernach, dass ich Ihnen noch so gut bleibe. Ich wünsche, dass Sie angenehmere Briefe, als die meinigen sind, antreffen mögen. Erinnern Sie Sich aber auch, dass Sie versprachen, mir einen solchen zu schicken.
Ich bin Ihre Freundin M. Moller
***[3] Festeres Gewebe aus Naturseide für das von F.G. Klopstock im vorherigen Brief erwähnte Kleid. Taft wird als Stoff für Kleidung vorwiegend in Korsetten, Hochzeitskleidern und Ballkleidern genutzt.
[4] Gemeint ist Hartmann Rahn (1721-1792). Er war ein Kaufmann aus Zürich, der mit Klopstock durch Hamburg nach Dänemark reiste, wo er eine Seidenfabrik gründete. Er heiratete später Klopstocks zweitälteste Schwester Johanna Victoria Klopstock.
Friedrich Gottlieb Klopstock an Meta Moller (17. April 1751)
Diesen Morgen empfange ich von dem kleinen süßen Mädchen einen lieben Brief und diesen Morgen schon (ich weiß selbst nicht, was mein unruhiges Herz alles damit haben will) muss ich dem süßen Mädchen wieder antworten.
Willkommener ist dem Anakreon[5] sein Liebling, seine weiße Taube, nicht auf die Leier und zu dem roten Zierbecher geflogen, als mir der Brief von der kleinen Mollerin kam. Wie sagt doch Anakreon davon? Ich möchte mich fast noch einmal an Ihnen rächen und es Ihnen sagen, wie Anakreon sagt. Nicht für die Mannsperson, an der Sie so böse sind, mich wieder zu erinnern, sondern dafür, dass Sie mich Herr Klopstock heißen und dann auch vornehmlich deswegen, dass ich Ihnen nicht einen einzigen Kuss habe geben dürfen. Kleines Mädchen, das werden Sie in Ihrem Leben nicht verantworten können, dass Sie das getan haben. Wahrhaftig, ich kann nicht eher weiterschreiben, eh ich mich nicht gerächt habe. Nur für jede Ihre beiden großen Bosheiten einen anakreontischen Vers. Nur das bisschen Rache.
[Auf Griechisch]:
O süße Taube,
Woher, woher fliegst du [daher]?
Nun schlägt mir mein Herz wieder sanfter. Nun gutes Kind, sein Sie nur nicht böse. Sündigen [...] Sie nicht mehr, so will ich nicht mehr strafen.
„Es ist, sagen Sie, aus einer kleinen Eitelkeit hergekommen, dass ich Sie so oft gefragt, ob Sie mir gut sein?“ Niemals hat ein Freigeist die [Heilige] Schrift schlimmer ausgelegt, als Sie mich hier erklären... Ich will nur wenig sagen. Oft wenn ich vor Ihnen stand und Sie mit meinem ganzen freundschaftlichen Herzen ansah; so waren‘s kaum Ihre Augen ganz, die mich bemerkten – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –?....!...[6]
[...]
***
[5] Anakreon aus Teos, griechischer Dichter (6. Jahrhundert vor Chr.): wurde von einem halleschen Studentenkreis, zu dem auch Johann Wilhelm Ludwig Gleim gehörte, im 18. Jahrhundert wiederendeckt. Im Zuge des sich entwickelnden Freundschaftskultes wurde Anakreon (als vermeintlicher Dichter des Weins, der Liebe und des Gesangs) als Vorbild für eine neue Dichtkunst betrachtet. Die von Anakreon überlieferten (oder ihm damals zugeordneten) Oden kennzeichnen sich durch eine starke Bildsprache und Leichtigkeit im Ton. Indem F.G. Klopstock sich mit zwei Zeilen aus der „Taubenode“ an M. Moller „rächt“ stellt er sie auch auf die Probe: versteht sie die Botschaft richtig, ist sie in seinen empfindsamen Freundeskreis aufgenommen.
[6] Die empfindsame Briefkultur des mittleren 18. Jahrhunderts beschäftigt sich intensiv mit der Darstellung von Gefühlen durch die Sprache. Dabei wird auch thematisiert, dass besonders überwältigende Gefühle in der (Schrift-)sprache gar nicht richtig ausgedrückt werden können. Dies kennzeichnet man dort, wo das Gefühl zu stark wird, gerne durch abgebrochene Sätze und Gedankenstriche. F.G. Klopstock vollzieht mit dieser Häufung an Gedankenstrichen außerdem die vielen Blicke nach, mit denen sich sein Herz und Metas Herz angesehen und einander als verbundene Seelen erkannt haben.
Meta Moller an Friedrich Gottlieb Klopstock (29. April 1751)
Niemals würde ich es Ihnen vergeben, kleiner unartiger Klopstock, dass Sie den Anfang von Anakreons Taubenode an mich, an ein Frauenzimmer, griechisch schreiben[7], wenn Sie nicht meinen Brief mit Anakreons Taube verglichen hätten. So sehr groß die Schmeichelei auch ist, dass mein Brief Ihnen so willkommen gewesen, als dem Anakreon seine Taube: So sehr angenehm ist sie mir doch.
Welche Freude Ihre Briefe mir verursachen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hoffe aber auch künftigen Sommer, Sie davon zu überzeugen. Sie müssen aber ja auch kommen mein lieber Freund. Ich tue mir schon sehr viel darauf zu gut. Wir wollen gewiss fleißig auf der Alster fahren und fleißig spazieren. Und dann so reisen wir auch nach Braunschweig, wissen Sie wohl? O wie vergnügt wollen wir da sein.
[...]
Vergessen Sie nie, dass Sie mein Freund sind, so werde ich gewiss beständig Ihre Freundin bleiben.
M. Moller
***[7] Klassische Sprachen waren für gewöhnlich nicht Gegenstand der Erziehung der bürgerlichen Mädchen im 18. Jahrhundert. Margareta Moller selbst beherrschte drei modernen Fremdsprachen und besaß Kenntnisse im Lateinischen. Um Klopstocks mit griechischen Buchstaben geschriebenes Zitat zu verstehen, musste sie also recherchieren. Dass sie dies tat und gleichzeitig Kenntnis von der Ode, aus der F.G. Klopstock zitiert, aufweist, beweist ihre Einbindung in ein bildungsbürgerliches Netzwerk in Hamburg ebenso wie das Engagement, das sie in den Briefwechsel mit F.G. Klopstock investiert.
Tiemann, Franziska und Hermann. Meta Klopstock: Es sind wunderliche Dinger, meine Briefe: Briefwechsel mit Friedrich Gottlieb Klopstock und mit ihren Freunden 1751–1758, München: Verlag C.H. Beck, Neuauflage 1988.
Die Orthographie wurde behutsam der heutigen Schreibweise angepasst. Formatiert und kommentiert von Anja Pönisch.
Übersetzung der Passage auf Griechisch durch Lukas Weiser.



